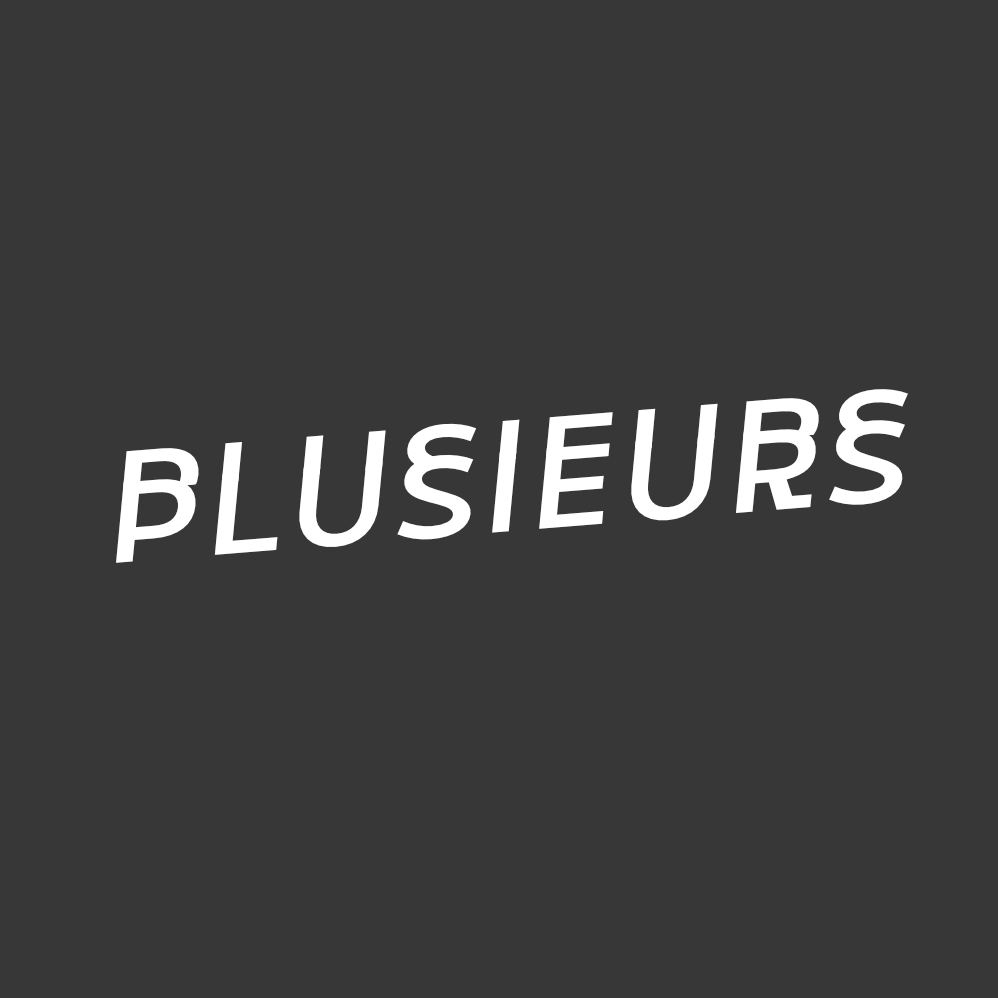Die ersten Worte von Els Moors als nationale Dichterin
Vor fünf Jahren war ich in Berlin. Ich ging viel zu spät zu Bett, obwohl ich wusste, dass ich dadurch riskierte, am nächsten Morgen meinen Flug nach Hause zu verpassen. An diesem Abend hatte ich kaum Geld dabei, aber Catherine, eine britische Übersetzerin von Poesie, schlug vor, uns die Kosten für ein Taxi nach Hause zu teilen. Catherine war ein Mann, der sich im Laufe der Jahre immer mehr zu einer Frau entwickelt hatte. Ihre tiefe Stimme und ihr fragil wirkender Körper gaben mir den Eindruck, dass ich zum ersten Mal wahrnehmen konnte, aus welchem Material Frauen und Männer tatsächlich bestanden. Obwohl ich mich für gewöhnlich nicht in Frauen verliebe, verspürte ich an diesem Abend für einen Augenblick das verwirrende Bedürfnis, Catherine zu verführen. Als ich am nächsten Morgen noch recht früh an einer eingeschneiten Haltestelle auf den Bus wartete, der mich zum Flughafen bringen sollte, tauchte der Bus nicht auf. Entmutigt wandte ich mich an einen Taxifahrer, der mir zu meiner Verwunderung vorschlug, mich kostenlos zum Flughafen zu fahren. Er erzählte mir, dass er im Ruhestand war, ab und zu aber noch Fahrgäste mitnahm. Dass ich vergeblich auf einen Bus wartete, so versicherte er mir, gab ihm die Möglichkeit, mit den Kollegen zu plaudern, die am Flughafen auf Fahrgäste warteten. Außerdem müsse er sowieso in diese Richtung, da er dort am Tag zuvor sein Portemonnaie vergessen hatte. Ungläubig angesichts der vielen Zufälle entwickelte sich ein vertrautes Gespräch mit dem Mann, der vor vielen Jahren aus dem Iran nach Deutschland gereist war. Er erzählte von Rumi und Hafez, den persischen Dichtern, die seiner Ansicht nach jeder gelesen haben müsste, und über die zentrale Rolle, die die Poesie im Mittleren Osten noch stets innehat. Im Iran sind die Werke von Hafez in nahezu jedem Haushalt zu finden und auch Jahrhunderte nach seinem Tod werden seine Verse noch gerne gelesen und zitiert. Von seinen beiden Töchtern forderte der Taxifahrer nur eines: dass sie möglichst lange unverheiratet bleiben und sich bis dahin auf ihr Studium konzentrieren sollten, um eigenständig ihren Weg ins Leben zu finden. Während wir im Zentrum des schlafenden Berlin eine Baugrube nach der anderen hinter uns ließen, stellten wir einstimmig fest, noch stets staufrei unterwegs zu sein. An einer roten Ampel wartend begannen wir mit einer Analyse des Zustands der Welt, und mein Fahrer meinte ziemlich trübsinnig, dass die Welt völlig anders ausgesehen hätte, wenn das Experiment des Kommunismus tatsächlich die Chance erhalten hätte, erfolgreich zu sein.
Am Lufthafen angekommen und nach einer langen Verabschiedung von meinem neuen Freund entdeckte ich, dass ich noch Zeit hatte. Ich setzte mich neben zwei Frauen, die in das Licht der aufgehenden Sonne getaucht auf einer Wand sitzend miteinander plauderten, und schlürfte an einem heißen Kaffee, während ich in Gedanken noch dem interessanten Gespräch mit meinem Fahrer nachhing. Aus einem Impuls heraus machte ich einer der beiden Damen neben mir ein Kompliment zu ihren fantastischen Sneakers. Geschmeichelt fragte die Frau prompt, ob ich kurz auf den Haufen Flaschen achten würde, damit sie gemeinsam mit ihrer Freundin auch eine Tasse Kaffee holen könnte. Ich hatte mich bereits über die Menge an leeren Flaschen gewundert, die aus dem Einkaufswagen und dem Einkaufstrolley hervorquollen, mir aber nichts dabei gedacht. Schließlich schleppte am Flughafen jeder das ein oder andere Gepäckstück mit sich. Erst, als ich alleine neben dem Haufen Flaschen auf die Rückkehr der beiden Frauen wartete und immer mehr fassungslose Blicke von umstehenden Personen erhalten hatte, begriff ich, dass mir entgangen war, dass die Frauen wahrscheinlich obdachlos waren, und dass ich jetzt selbst auch wie eine Obdachlose aussah. Verborgen hinter einem Berg leerer Flaschen, die ich gegen Flaschenpfand einlösen könnte. In einem unbeobachteten Moment hatte ich die Grenze zur anderen Seite einer Zivilisation überschritten, die ich zu kennen meinte, jedoch noch nie aus dieser Perspektive gesehen hatte. Ich sah die Vorurteile der Gemeinschaft, von der ich dachte, auch Teil davon zu sein, und die meinen Blick schon immer getrübt hatte, zum ersten Mal glasklar in den Augen derer, die mich anstarrten.
Und heute, so viele Jahre später, in dem Moment, in dem ich beschließe, diese Ereignisse als Einführung für meine Rede zu verwenden, wird mir plötzlich klar, dass Catherine und der Taxifahrer und die beiden obdachlosen Frauen und ich uns unausgesprochen über eines einig waren. Begriffe wie „Mann“ und „Frau“, „Kapitalismus“ und „Kommunismus“, „Gemeinschaft“ und „Individuum“ haben die hartnäckige Eigenschaft, einander ausschließen zu wollen, als ob sie ausschließlich totalitär funktionieren und keine Gleichzeitigkeit vertragen könnten. Es gibt Milliarden von Varianten des männlichen Körpers, aber kein einziger Körper verwandelte sich je aus eigener Kraft in einen Frauenkörper. Ich erinnere mich noch lebhaft an den Moment, an dem ich in einem Aquarienhaus mit einem geschlechtslosen Fisch konfrontiert wurde, der sich über einen Umweg trotzdem fortpflanzen konnte. Zum Zwecke dieser Rede versuchte ich, den Namen dieses Fisches in Erfahrung zu bringen. Als ich den Suchbegriff „Fisch ohne Geschlecht“ eingab, erschien unter den ersten Suchergebnissen „Angelina Jolie lieh auch dem Fisch Lola in dem DreamWorks-Animationsfilm „Shark Tale“ (2004) die Stimme“ usw.
Zurück zum Wesentlichen. Genauso, wie die Begriffe „Mann“ und „Frau“ einander ausschließen möchten, sind Hunderte Varianten des Kapitalismus denkbar, aber bei keiner einzigen besteht die Gefahr, dass sie sich von selbst in eine Art Kommunismus entwickelt. Wahrscheinlich ist es gerade unsere demokratische westliche halbherzige kommunistische Variante des Kapitalismus, die uns stets aufs Neue ein betörendes Konzept von Pseudo-Gerechtigkeit vorgaukelt, wodurch wir auch weiterhin erbittert an diesem verheerenden Irrtum festhalten. Geradezu umso unbeugsamer fristete der Gedanke daran, wie eine gerechte Welt auszusehen hat, seine hartnäckige Lüge tief in jedem von uns. Um zu wissen, welche Frau Catherine geworden war, und um sie zu lieben, musste ich zunächst mich selbst drastisch umbauen. Auch die Geschichte hat bewiesen, dass die Kopernikanische Wende, die der Kommunismus darstellte, dazu verdammt war, in großem Umfang zu scheitern. Ich konnte mich selbst nicht ändern und ebenso wenig konnte ich von Catherine, die sich als Frau fühlte, verlangen, dass sie doch ein Mann bleiben müsse, damit ich mich nicht ändern musste. Zu fordern, dass die kapitalistische Welt von sich aus gut sein sollte, da wir nun mal dachten, dass es höchste Zeit war, dass sie uns ein menschlicheres Gesicht zeigt, bedeutete mit anderen Worten, an einen grausamen Gott zu glauben.
Auf vergleichbare Weise erschien es mir zunächst unmöglich, das Amt des Nationalen Dichters anzunehmen, ohne zuerst bei mir selbst und anschließend am Vaterland einige dringend notwendige und einschneidende Änderungen vorzunehmen. Ausgehend von diesem Blickwinkel begann ich, Texte von Dichtern zu lesen, die Volk und Vaterland bereits früher adressiert hatten, wie auch ich heute eine Ansprache vor dem Volk halten muss – vorausgesetzt, dass ich dieses Amt annehme. Überrascht stellte ich fest, dass auch Dichtern vor mir der Gedanke, Reden vor der Gemeinschaft zu halten, unangenehm war. Und es kam noch schlimmer. Offenbar wütete bereits seit Jahrhunderten ein nicht nachlassender Krieg zwischen den Dichtern und den sie umgebenden Gemeinschaften; ein Krieg, der bereits vor über 2 000 Jahren in dem Vorschlag mündete, alle Dichter ein für alle Mal aus dem Staat zu verbannen. Platos Gedankengang kann wie eine brutale Überraschung und ein bitteres Schicksal wirken, aber der meist gefeierte Dichter Flanderns, Paul van Ostaijen, erkannte 1927, dass „jeder „echte“ Dichter das platonische Staatspostulat, das kurzen Prozess mit den Dichtern machen wollte“, selbst verstand. Als links orientierte Künstlerin verlange auch ich danach, leichtfüßiger Teil einer knallharten Opposition zu sein, aber angesichts unserer gegenwärtigen gefährlich rechten, defätistischen, apolitischen und jede Verantwortung hinsichtlich der Geschichte verweigernden Regierung verdient diese Aufgabe meiner Ansicht nach kein Lob und schon gar nicht einen Ehrentitel „Nationaler Dichter“. Es handelt sich dabei einzig und allein um gesunden Menschenverstand. Was mir bezüglich des Titels „Nationaler Dichter“ Sorgen bereitete, war das Folgende: Vielleicht war es höchste Zeit, zumindest mir selbst einzugestehen, dass ich nur noch staatsgefährdende Gedichte schreiben wollte, dass ich die von Plato angeregte Verbannung aus dem Staat ein für alle Mal leidenschaftlich begrüßen würde. Ich kämpfte nicht nur mit meinem für die Gesellschaft überflüssigen und endlos dämonisierten Frausein, das der Liebe zwischen Catherine und mir für immer im Weg stehen würde; es stellte sich nicht nur heraus, dass ich nicht Manns genug war, mich dem grausamen Kapitalismus zu stellen und mithilfe eines unerschrockenen Taxifahrers eine demokratische Form des Kommunismus zu verteidigen; sondern ich war, wie mir schmerzhaft bewusst wurde, auch noch fleißig damit beschäftigt, dem Druck einer imaginären Heimat und eines imaginären Dichtertums zu erliegen. „Du bist erst dann dein Beruf, wenn du diesen ausübst“, warnte meine Mutter mich immer. Sollte der Begriff „Nationaler Dichter“ mich dazu zwingen, außerhalb des Schreibeprozesses Dichterin zu sein? Es fühlte sich plötzlich an, als hätte ich all die Jahre nicht gewusst, was ich eigentlich tat.
Der Ausweg aus der Sackgasse kam aus einer unerwarteten Ecke. Vor einigen Woche war der französische Antiphilosoph Alain Badiou unter anderem von Midis de la Poésie eingeladen worden, über sein Buch „Que pense le poème“ (2016) zu sprechen. Nun war ich stets der Meinung, dass man bei Problemen besser einen Philosophen konsultieren sollte als einen Dichter. Es verwunderte mich dann auch, dass ein Antiphilosoph wie Badiou vom Entgegengesetzten ausgehen wollte. Als Philosoph profitierte er enorm davon, dem Gedicht und im weiteren Sinne der Poesie ein ganzes Buch zu widmen, und er war nicht abgeneigt, diese Wahl in Brüssel zu verteidigen. „Que pense le poème“ ist eine Sammlung einer Reihe von Vorträgen und Essays, die Badiou im Laufe der Jahre über die Poesie verfasst hat. In diesen Texten definiert Badiou das Gedicht und im weiteren Sinne die Poesie, indem er beide als „bâtardise“ oder Verfälschung der philosophischen Sprache und des philosophischen Denkens selbst direkt neben die Philosophie stellt. Das Denken, das die Poesie darstellt, muss laut Badiou als ein Tun betrachtet werden. Es handelt sich dabei um ein Denken, das nicht an Wissen verknüpft ist, und um ein Denken, das objektlos bleiben möchte, da es eben jede Form von Vernunft auslöschen möchte. Die Poesie, so Badiou, entfernt sich in unserer heutigen Welt leider immer mehr von uns, da sie unsere Forderung, sie solle verständlich, begreifbar und klar sein, nicht ertragen kann. Die Poesie will kein passives Publikum, dem sie eine simple Botschaft verkünden kann. Das Gedicht hingegen ist eine Übung in Unbeugsamkeit. Das Gedicht ist ein Akt der Unversöhnlichkeit und lässt sich auch nicht mediatisieren. Die Demokratie des Stichprobenmittelwerts, so meint Badiou, wird durch das rebellische Wesen des Gedichts mühelos zunichtegemacht.
Dies ist nur ein kleines Beispiel für die unbezwinglichen Eigenschaften, die Badiou der Poesie und dem Gedicht zuschreiben wollte, und noch nie zuvor durfte ich klarere Sätze darüber lesen, worum es mir als Dichterin auch geht. Dennoch waren alle spezifischen Eigenschaften, die Badiou dem Gedicht zuschrieb, ebenso gültig und ungreifbar wie die Liebe selbst. Auch die Liebe war von Natur aus etwas Widerspenstiges und argumentierte am liebsten gegen die Vernunft. Sie ließ sich weder in Mittelwerten noch in Formeln einfangen und wurde bereits von mehr als einem Barden unterschätzt, wodurch sie häufig beinahe zum totalen Untergang geführt hat. Die Feststellung, dass Badiou die Poesie genauso irrational, frei und gleichgültig machen wollte, enttäuschte mich. Ich befürchtete, dass Badiou die Poesie somit vom guten Willen der Believer und Nonbeliever abhängig machen wollte. In unserer Gesellschaft sind es dann auch die Frauen und Kinder, von denen stets angenommen wird, dass sie wüssten, was es bedeute, zu lieben, und aus genau demselben Grund werden wir mittlerweile ausschließlich von herzlosen Schurken regiert.
Musste ich die Definition der Begriffe „Liebe“, „Kapitalismus“, „Poesie“, „Heimat“ erweitern, bis jeder Begriff groß genug war, um uns über alle unvereinbaren Gegensätze hinweg für immer aneinander zu binden? Während ich in Gedanken damit begann, diesen imaginären Tunnel, der die Worte waren, wie ein Bergarbeiter mit meinen Händen zu verbreitern, indem ich Erde daraus kratzte, begriff ich die Idiotie hinter einem solchen Vorhaben. Es würden zweifellos andere Catherines kommen, andere, auf die ich noch nicht vorbereitet war, und diese anderen würden mich dazu verpflichten, neue und noch breitere Tunnel zu graben; eine Sisyphusarbeit, auf die ich aufgrund meines faulen Charakters – und sei es dann noch im Auftrag des Vaterlandes – gerne verzichtete. War es vorstellbar, dass Catherine und ich einander all die Zeit geliebt hatten, und es aber gerade dieses Wort „Liebe“ war, dass uns den Weg zueinander versperrt hatte? Ließ es sich verantworten, eine Angelegenheit auf diese Art umzudrehen? In diesem Fall würde sich nur 1 Prozent der gesamten Weltbevölkerung dazu bereit erklären, sich hinter dem Gesamtkapital dieser sich durch Gemeinschaftssinn regierten Welt zu verschanzen. Die übrigen 99 Prozent würden der Armut Treue schwören und darüber hinaus, so folgerte ich zögernd und wider besseres Wissen, auf Gefahr des eigenen Lebens und mit dem wenigen Geld, das ihnen gegönnt war, auch noch freiwillig aus eigener Tasche allerlei Politiker und Menschen mit sogenanntem Sachverstand bezahlen, um sich so zumindest die gewissenlosesten Großverdiener und Schurken möglichst weit vom Hals zu halten. Gibt es irgendwo auf der Welt ein Vaterland und eine Muttersprache, die stark und inspirierend genug waren, um mich in den paraten Zustand der wachen Poesie zu zwingen? Wenn ein Grund dafür bestand, weshalb ich es all die Jahre hindurch ausgehalten hatte, Menschen zu lieben und Gedichte zu schreiben, dann nur, weil ich während all dieser Zeit über ein beeindruckendes fehlendes Langzeitgedächtnis verfügen durfte. Ich vergaß jedes Gedicht, noch bevor ich es geschrieben hatte, wodurch ich jedes Mal aufs Neue ein anderes schreiben musste, und nur die langweiligsten Liebhaber hielten auf Dauer durch, mir die Tür einzurennen, auch wenn es schon längst aus war zwischen uns. Es war mir gelungen – und im Laufe der Zeit immer geschickter – jede Form von Heimat zu umgehen, und möglicherweise erfüllte mich dieser Umstand mit mehr Stolz als die paar Gedichte, die ich je verfasst habe. Poesie, Heimat, Liebe – wenn es sich dabei um Begriffe handelte, nach denen ich mich sehnte, dann sehnte ich mich doch noch stärker danach, ewig vor deren Unbeugsamkeit zu fliehen. Die Begriffe „Liebe“, „Poesie“ und „Heimat“ standen als scheinbar begehbare Brücken zwischen den Menschen und den Dingen. Als solche waren sie ebenso einfach zu überqueren wie in die Luft zu jagen. Ich hätte die Überquerung von mir zu Catherine machen können, hätte ich das gewollt. In diesem Fall hätte ich den Begriff „Liebe“ eingesetzt, da ich gewusst hätte, dass Catherine sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Diese Erkenntnis wäre eine unmittelbare Erfahrung gewesen, über die ich nicht nachdenken hätte müssen. Ich hätte die Brücke der Liebe dann gesehen, noch bevor diese existiert hätte, und wäre wie von selbst darüber gelaufen. Wenn aber die Brücke der Liebe die Verbindung zwischen zwei Individuen legt, stellt sich die Frage, was die Brücke verband, die die Poesie war? Van Ostaijen begann, sich als Dichter an die Gemeinschaft zu wenden, um anschließend derselben Gemeinschaft gekränkt den Rücken zuzukehren: „Also pass auf: Wenn ich dichte, tue ich das, weil ich darauf vertraue, nichts und zwar absolut nichts zu sagen zu haben.“ Musste ich hieraus konkludieren, dass die Brücke der Poesie zwischen dem Dichter und der Gemeinschaft genauso wie die Liebe eine trügerische und gefährliche Brücke war? Eine Brücke, deren Standort der Dichter im besten Fall kannte, während er gleichzeitig aber auch versuchte, die Leser vor dieser Brücke zu behüten? War die Brücke durch Zutun der Dichter selbst so schmal und unbegehbar geworden, dass man sich besser nicht an deren Überquerung wagte? Aber was wurde in diesem Fall mithilfe der Sprache eigentlich transportiert? Wenn ich Catherine liebte und die Überquerung mithilfe des Begriffs „Liebe“ wagte, was transportierte ich dann anderes als mich selbst?
Vielleicht war es mein begrenztes Wissen über Philosophie, das mir während der Lektüre von Badiou Streiche spielte. Vielleicht war ich zu viel Dichterin, um die Poesie mit einer ausreichend großen philosophischen Distanz betrachten zu können. Ich verlief mich immer und immer weiter, bis ich eines Morgens aufwachte und beschloss, dem Beispiel Badious zu folgen und dem Druck des Vaterlandes nachzugeben. Ich würde mein Dichtertum erneut definieren, indem ich es im Auftrag des Vaterlandes erneut situieren würde. Badiou definierte die Poesie, indem er sie, als korrupt bezeichnet, direkt neben die Philosophie stellte. Wenn irgendwo auf der Welt eine imaginäre Brücke die Begriffe „Gemeinschaft“ und „Poesie“ miteinander verband, so dachte ich, war ich doch all die Zeit hindurch selbst diese Brücke gewesen. Auf der einen Seite der Brücke, so entschied ich, befand sich die Sprache, und diese Sprache war Eigentum der Gemeinschaft. Ich hatte diese Sprache gehört und geerntet und eines Tages aus Neugier und auf gut Glück aus mir selbst eine Brücke gebaut, um bestimmte Elemente an eine imaginäre gegenüberliegende Seite zu befördern. Oder vielleicht bildete ich mir ein, dass ich meinen Körper bearbeiten musste, bis dieser sprachlich geworden wäre? Warum? Auch mein Verhalten ist wahrscheinlich als korrupt und symptomatisch zu bezeichnen. Für mich bestand keine andere Art zur Bekämpfung der eingebildeten Krankheit, an der ich dachte zu leiden, und die ich in meinen dunkelsten Momenten mit dem Begriff „Gemeinschaft“ bezeichnen hatte wollen. Wo hoffte ich in meiner Funktion als Brücke zu landen? Wo lag die gegenüberliegende Seite? Die Antwort, so dachte ich eher betrübt, würde jedes Mal aufs Neue mit jedem neuen Gedicht und jedem neuen Dichter ein anderes Gesicht erhalten. Erst damals wurde mir plötzlich bewusst, dass ich diese Rede eigentlich für Badiou geschrieben hatte. Badiou hatte seinem Buch den poetischen Titel „Was denkt das Gedicht?“ gegeben, um dann ein ganzes Buch lang zu erklären, dass das Gedicht nicht denkt, sondern tut. Dichter waren für Badiou gescheiterte Philosophen, die im Körper eines Dichters gefangen waren und es dennoch nicht lassen konnten, auf korrupte Art zu philosophieren. Als ich mein Buch nach der Lesung von Badiou signieren lassen wollte, hatte ich den Eindruck, dass eher er als korrupter Dichter denn als Philosoph auftrat. Er schwitzte noch, lächelte mürrisch und wollte meinen Vornamen unbedingt richtig buchstabiert wissen, bevor er mit schwarzer Tinte und gequältem Blick die erniedrigende Pflicht des Signierens in Angriff nahm. Ich kannte diesen Blick nur zu gut. Wer Papier wirklich liebt, hält es für eine Katastrophe, in seinem eigenen Buch die letzten jungfräulichen Seiten auf Anordnung Fremder mit Trivialitäten zu füllen. Ich versuchte, meinen Namen laut zu buchstabieren, stand aber zu weit weg, und Badiou, ein charmanter alter Mann mit üppigem Nasenhaar und buschigen Augenbrauen, konnte mich nicht hören. Ein stämmiger Mann, der ein weniger näher stand, wollte vermitteln, obwohl auch aus seinen Augen sprach, dass „Els“ definitiv ein „e“ oder „a“ fehlte. Ein Vorname, meinte Badiou mit einem strengen an uns gerichteten Blick, sei lebenswichtig. Einen Vornamen möchte ich nicht verkehrt schreiben. Und trotzdem schrieb er: Pour Els(e), mit einem „e“ zu viel, und dann „un jour à Bruxelles … drei Punkte, Alain Badiou.“ Diese mysteriöse Widmung ist, so ist mir jetzt klar, gleichzeitig das schönste und das schlechteste Gedicht, das ich je gelesen habe. Es belegt aber vor allem den letzten Punkt, den ich noch besprechen möchte. Dass ich kein Problem mit Badious Meinung habe, dass Dichter immer gescheiterte Philosophen bleiben müssen. Ich weiß meinerseits nur zu gut, dass besser in jedem genialen Philosophen auf ewig ein gescheiterter Dichter schlummert. Ich möchte Badiou eines Tages aber doch gerne fragen, warum er nicht angemerkt hat, dass alle Dichter aus dem Staat verbannt werden müssen, da sie sich immer und ausnahmslos aus freiem Willen durch die Liebe korrumpieren haben lassen.
Meine Aufgabe als „Nationale Dichterin“ begann eigentlich im vergangenen Jahr, als ich als Botschafterin der vorherigen Nationalen Dichterin, Laurence Vielle, eingeladen wurde, am Projekt „Ronde van België“ teilzunehmen. Laurence träumte davon, die manuelle Denkarbeit des Dichters in der Muttersprache mit einer realen Denkübung der Füße zu verknüpfen, durch den tastbaren Raum unserer zerrissenen Heimat hindurch. Das Ergebnis unserer Expedition möchte ich aufgrund der Auswirkungen, die diese Reise auf mich hatte, als erstes Gedicht dem heimischen Publikum vorlegen. Neben der zweimonatlichen Veröffentlichung eines Gedichts sowie der Fortsetzung und Unterstützung einer Reihe bestehender und dynamischer Projekte wie Belgium Bordelio gibt es bereits jetzt einige Projekte, über die ich in den nächsten Monaten laut nachdenken möchte, und die ich hoffentlich gemeinsam mit Ihnen realisieren kann. Ein Nationaler Dichter oder eine Nationale Dichterin verdient eine königliche Residenz. Wir arbeiten an einer Kooperation mit dem Natuurpunt des Zoniënwoud und des Hippodroom, um eine Autorenresidenz inmitten der Ruhe des Zoniënwoud in der Königlichen Loge zu organisieren; dem Ort, an dem König Leopold II. Pferderennen verfolgte. Gemeinsam mit Laurence Vielle möchte ich die Einladung des Komponisten Guy van Waes annehmen, das auf einem Wiener Pianoforte aus dem Jahr 1790 ausgeführte „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ durch sieben zeitgenössische Texte zu ersetzen und in neuer Form auf die Bühne zu bringen. Ich plane eine definitive Kooperation zwischen der Initiative Nationaler Dichter und der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, wo ich während meiner Belgien-Rundreise so herzlich vom Medienzentrum empfangen wurde. Ich möchte Mittel sammeln, um gemeinsam mit der arabischen Gemeinschaft ein neues und zweijährlich stattfindendes Festival für arabische Poesie in Brüssel zu starten. Mohamed Ikoubaân, Direktor des Festivals Moussem, argumentierte vor einiger Zeit in der belgischen Tageszeitung de Standaard, dass in Brüssel Arabisch an dritter Stelle der meistgesprochenen Sprachen liegt, die Akzeptanz des Arabischen oder einer anderen Fremdsprache im Alltag aber noch ganz anders aussieht. Es ist selbstverständlich, so Mohamed, dass in einem Land eine gemeinsame Sprache benötigt wird oder gemeinsame Sprachen benötigt werden, um eine gemeinsame Kommunikation und ein Zusammenleben zu ermöglichen. Es hindert uns aber nichts daran, die Sprachen unserer neuen Mitbürger zu schätzen und diesen einen Platz zuzugestehen. Als Dichterin möchte ich auch ein offenes Ohr für diesen Aufruf und frühere Apelle haben, Arabisch nicht nur auf die Sprache des Koran und des Islam zu reduzieren. Wahrscheinlich muss man selbst lange genug im Ausland gelebt haben, ehe man versteht, was es bedeutet, wenn sich das öffentliche Leben ausschließlich in anderen Muttersprachen abspielt. Während der ersten Jahre, die ich in Amsterdam wohnte, schossen mir im Zug nach Hause Tränen in die Augen. Einfach aus dem Grund, dass ich nach Wochen in der niederländischen Diaspora zum ersten Mal wieder jemanden Flämisch sprechen hörte. Stellen Sie sich vor, taub geboren zu sein und zum ersten Mal ein Gedicht zu lesen. Es ist nicht unmöglich, sich vorzustellen, dass ein solches Gedicht wahnsinnig in den Ohren widerhallt. Eine Muttersprache funktioniert möglicherweise auf entgegengesetzte Art. Es ist der stille und sogar unhörbare, aber dadurch nicht minder sanfte Klang der ersten Worte, mit denen jeder Mensch einst Kontakt mit Sprache legte. Jeder, egal wo auf der Welt, hat das Recht, in dieser ermutigenden Stille Zuflucht zu suchen, und meiner Ansicht nach kann es Teil des Projekts „Nationaler Dichter“ sein, dieselbe Stille gleichzeitig und in möglichst vielen Sprachen klingen zu lassen.
An erster Stelle danke ich der Nationalen Lotterie und ihren Spielern sowie dem Kulturellen Kooperationsvertrag zwischen der flämischen und der französischen Gemeinschaft für die finanzielle Unterstützung dieses Projekts. Ich möchte diese Rede gerne mit zwei Zitaten meiner Vorgänger abschließen. Charles Ducal schrieb: „Für uns – Organisatoren, Dichter, Übersetzer und alle anderen Beteiligten – besteht die Funktion des Nationalen Dichters in einer Tat wohlverstandenen Eigennutzens, einer Chance für die Poesie, ihre Existenzberechtigung gegen alle Lauheit und Minimalisierung als evident zu verteidigen.“ Laurence Vielle ergänzte zwei Jahre später: „Möge das Projekt Dichter des Vaderlands, Poète National, Nationaler Dichter eine grenzenlose, solidarische Bewegung für eine poetische Re-Evolution sein, eine lebendige Brücke zwischen dir und mir.“ „Nationaler Dichter“ ist in erster Linie ein gemeinsames und dynamisches Projekt einer evidenten, darum aber nicht weniger solidarischen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wird immer größer. Es freut mich, gerade mit diesen unentbehrlichen Partnern rund um den Nationalen Dichter zusammenarbeiten zu dürfen: Poëziecentrum in Gent mit Carl, Lot, Sieglinde und Stefaan, VONK und Zonen mit Michäel und Lotte, Passaporta mit Ilke und Adrienne, das Übersetzerkollektiv mit Bart und Isabel, Midis de la Poesie mit Mélanie, maelstrÖm reEvolution in Brüssel und Maison de la Poésie d’Amay mit David und Simona, Maison de la Poésie Namen mit Charlotte, Aline, Anne und Manon, Poème 2 mit Dolorès und Elsa, Jeugd en Poëzie mit Flore, und allen anderen, die direkt oder indirekt an dem Projekt beteiligt sind und die ich hier vergessen habe. Ich fühle mich durch die Tatsache gestärkt, dass ihr Vertrauen darin habt, dass ich den äußerst lobenswerten Irrtum Nationaler Dichter nicht größer machen werde als unter den gegenwärtigen Umständen irgendwie nötig ist. Ich möchte Laurence Vielle und Charles Ducal von ganzem Herzen dafür danken, dass sie die Aufgabe als „Nationaler Dichter“ vor mir mit äußerster Leidenschaft übernommen haben. Es ist ihrer Unerschrockenheit zu verdanken, dass ich heute den Mut habe, diese Aufgabe anzunehmen.