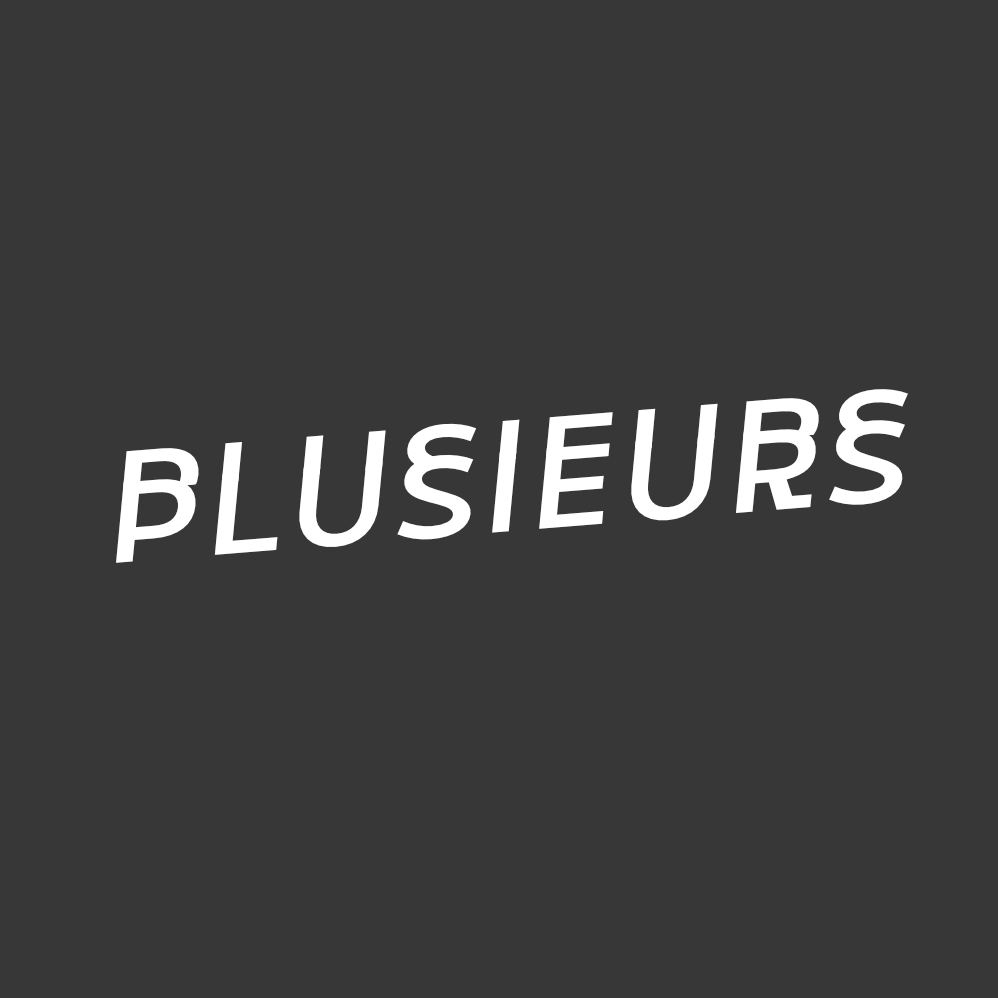Das sechste Gedicht von Carl Norac
STILL STANDING
Aus dem überfüllten Zug,
dem Gewimmel der Menschen,
die ans Meer ziehen, um den Deich
mit ihrem Atem, mit Papierblumen zu füllen,
und ihre Wunden zu lecken,
geht er zum Theater
und betritt den leeren Saal.
Heute sollte er dort seine Wege beschreiben,
ein simpler Kratzer der Zeit, der sich in Licht verwandelt,
Gedicht wie Sand oder Kiesel, niemals Asche,
mit diesen scharfen Krallen,
die die Handfläche besänftigt gegen den Blick der anderen.
Niemand da. Vor der verschlossenen Tür
diese roten Stühle zugeklappt wie Austern,
im Stehen liest er trotzdem vor. Nicht für sich selbst.
Er schickt seine Worte in alle Winde,
dass sie als Landschaft dienen mögen, den Platz
der Abwesenden einnehmen, die sich, vielleicht,
durchströmen lassen hätten.
Bei der letzten Strophe hebt er die Stimme
schwungvoll, als ob seine Sätze
ein kleines bisschen Pulver enthielten.
Wer weiß? Die Poesie sprengt manchmal Schlösser.
Und genau das geschieht.
Durch diesen winzigen Luftzug zur Straße hin
strömen Passantinnen und Passanten langsam herein,
setzen sich, indem sie
die roten Samtmuscheln aufbrechen.
Nichts bewegt sich mehr.
Der Mann schweigt einen Moment
und diese erste Stille vor versammeltem Publikum,
die nur dem Gesetz des Glücks gehorcht,
sie gemeinsam zu durchbrechen,
zerplatzt plötzlich wie ein Gesang.
Was tut es gut, in sich ein Wort wiederzufinden,
das nicht gehorsam ist, sich nicht lässt binden.
Übersetzung: Christina Brunnenkamp